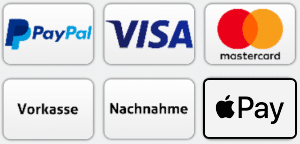Infrarotheizung im Altbau: Lohnt sich das Heizen mit Infrarot?

Bildquelle: © 2mmedia – stock.adobe.com
Die einen sagen, die Stromkosten für Infrarotheizungen seien unverhältnismäßig hoch, die anderen erklären, im Heizen mit Strom liege die Zukunft: Wenn es um das Beheizen von Altbauten geht, scheiden sich die Geister. Doch kann man tatsächlich pauschal sagen, dass das Heizen mit Infrarot im Altbau teurer ist als andere Heizsysteme? Dieser Frage gehen wir im Ratgeber auf den Grund.

Bildquelle: © 2mmedia – stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis
- Ab wann ist ein Haus ein Altbau?
- Verbrauch einer Infrarotheizung im Altbau
- Stromverbrauch und Kosten beim Infrarotheizen berechnen: So geht’s
- Lesetipp
- Infrarotheizkörper als alternative Heizung im Altbau?
- Den Altbau mit Infrarot beheizen: Ja oder Nein?
- Unsere Produkttipps für Ihre Altbauwohnung
- FAQs: Häufig gestellte Fragen zum Thema “Verbrauch im Altbau”
Ab wann ist ein Haus ein Altbau?
Einen Altbau beheizen ist teuer, heißt es oft. Aber was bedeutet eigentlich Altbau? Laut österreichischem Mietrecht spricht man – grob gesagt – von einem Altbau, wenn die Baubewilligung vor dem 30. Juni 1953 erteilt wurde. Alles nach diesem Datum gilt theoretisch als Neubau. Auch die Beschaffenheit des Gebäudes und die Bauweise, wie sie einer bestimmten Zeitperiode zugeordnet werden kann, spielen eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen Alt- und Neubau.
Altbau ist aber nicht gleich Altbau, denn viele Gebäude sehen zwar von außen alt aus, sind aber grundsaniert und längst nicht mehr zugig, so wie man es sich gerne einmal vorstellt. Das bedeutet: Nur, weil es sich laut Definition um einen Altbau handelt, muss das nicht heißen, dass das Gebäude schlecht gedämmt und ungeeignet für Infrarotheizungen ist. Auf der anderen Seite kann ein Altbau natürlich auch das Ausschlusskriterium sein.
Verbrauch einer Infrarotheizung im Altbau
Infrarotheizkörper haben den großen Vorteil, dass sie vergleichsweise günstig in der Anschaffung sind und keine Wartungskosten verursachen. Bringt das zu beheizende Gebäude aber ungeeignete Voraussetzungen mit, können die Stromkosten recht hoch sein, sodass sich das Heizen mit Infrarot weniger lohnt.
Sehen wir uns zunächst an, was über den Stromverbrauch einer Infrarotheizung entscheidet. Wichtig sind in erster Linie folgende Faktoren:
Dämmung des Hauses
Baumaterial
Baujahr des Gebäudes
Durchschnittliche Witterungsverhältnisse
Zahl der Außenwände im zu beheizenden Raum
Betriebsdauer
Leistungsklasse in Watt
Im so manchem Altbau sind die Wände noch schlecht isoliert. Auch ein sehr verwinkelter Raum beeinflusst den Verbrauch. Vorteilhaft ist im Altbau allerdings die Tatsache, dass beim Heizen mit Infrarot keine warme Luft nach oben steigt und somit keine Wärme verloren geht. Die direkte Wärmestrahlung sorgt in Bodennähe für angenehme Temperaturen – das kann eine Konvektionsheizung im Altbau nicht bieten.
Ein weiteres Merkmal, das ein Altbau gerne einmal mitbringt, sind feuchte Wände. Die Konvektionsheizung kann dagegen wenig ausrichten, im Gegenteil: Der hohe Unterschied zwischen Raum- und Wandtemperatur führt bei entsprechender Luftfeuchtigkeit schnell zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel. Eine Infrarotheizung hingegen hilft, die Feuchtigkeit auszutrocknen, sodass man Schimmel vorbeugen kann.
Es kann passieren, dass für effizientes Heizen mit Infrarot im Altbau eine energetische Sanierung nötig wäre. Wanddämmung und neue Fenster können in einem Einfamilienhaus gut und gerne Kosten von über 10.000 Euro verursachen.
Zu diesem Zweck müssen Sie Ihren Heizwärmebedarf kennen, wie er im Energieausweis zu finden ist. Dieser gibt Auskunft darüber, wie viel Strom Sie tatsächlich verbrauchen. Ein Infrarotstrahler läuft übrigens nicht konstant auf der Stufe des maximalen Verbrauchs, sondern heizt nur noch in Intervallen, sobald er fertig aufgewärmt ist. Wann dieser Punkt erreicht ist, können Sie mit einem regulierbaren Thermostat steuern: Dieses Zusatzfeature sorgt mitunter für beträchtliche Ersparnisse.
Die Formeln zur Berechnung des Heizbedarfs, wie man sie von Konvektionsheizsystemen kennt, greifen beim Heizen mit Infrarot also nicht. Aber wie bekommt man nun einen Überblick, welche Kosten die Infrarotheizung verursachen wird?
Stromverbrauch und Kosten beim Infrarotheizen berechnen: So geht’s
Für die Berechnung der Stromkosten bei einer Infrarotheizung brauchen Sie den Strompreis in Euro pro Kilowattstunde (kWh) sowie die Leistung (in Watt) Ihres Heizelements.
Wie erwähnt, sind diese theoretischen maximalen Stromkosten bei einer Infrarotheizung aber nicht ganz korrekt, da ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch intervallartig geheizt wird. An dieser Stelle wird nun die Heizrate wichtig. Damit ist gemeint, wie lange pro Stunde der Heizkörper tatsächlich aktiv Strom verbraucht. Wird in einem mittelmäßig gedämmten Altbau zum Beispiel 60 Minuten aufgeheizt, benötigt das Infrarotpaneel nur rund 50 % der Zeit aktiv Strom – also 30 Minuten lang.
Wird die Heizrate also mitbedacht, können Sie mit rund 0,20 € pro Betriebsstunde rechnen – 0,14 € unter dem Maximalwert! Allerdings sollten Sie auch einkalkulieren, dass Strompreise natürlich schwanken können und sich dadurch ein höherer Preis ergeben kann.
Womöglich brauchen Sie in Ihrer Altbauwohnung zudem mehr als eine Infrarotheizung und/oder eine Leistungsklasse mit mehr als 1200 Watt, wenn das Haus schlecht isoliert ist. Es kann auch sein, dass Sie mehr als die durchschnittlich 170-180 Tage im Jahr heizen müssen. All diese Faktoren können die Kosten in die Höhe treiben, das genannte Altbau-Rechenbeispiel ist also eher als Orientierung denn als Richtwert zu verstehen.
Infrarotheizkörper als alternative Heizung im Altbau?
In einem vielzitierten Bericht der Technischen Universität Kaiserslautern wird erwähnt, dass Infrarotheizungen eine sinnvolle Alternative zur Gasheizung und anderen Heizmethoden darstellen können. Der Bericht, den viele Hersteller als Werbeargument einsetzen, besagt allerdings ebenso unmissverständlich, dass „das Gebäude [für] die Beheizung durch eine Infrarotheizung geeignet sein [muss].“
Was bedeutet das nun für die Infrarotheizung im Altbau? Im Prinzip vor allem eines: Es kommt auf den Einzelfall an. Ist ein Altbau buchstäblich in einem „alten“ Zustand, hält das Stromnetz der Belastung womöglich nicht stand und eine Modernisierung wäre nötig.

Infrarotheizungen eignen sich auch für Altbauwohnungen. (Bildquelle: © niklask19312049 – stock.adobe.com)

Infrarotheizungen eignen sich auch für Altbauwohnungen. (Bildquelle: © niklask19312049 – stock.adobe.com)
Wann die Infrarotheizung im Altbau sinnvoll ist
Handelt es sich aber – wie bei den meisten Altbauten heutzutage – um ein gut erhaltenes, saniertes Gebäude, sieht die Situation gleich ganz anders aus. Niedrigere Heizkosten sind dann nicht auszuschließen, zumal Anschaffung und Installation bei einer Infrarotheizung sehr kostengünstig und einfach sind.
Außerdem lässt sich diese Heiztechnologie bedarfsgerecht steuern, sodass vor allem in größeren Häusern nur genau die Räume bzw. Bereiche beheizt werden, in denen man es gerade warm haben möchte. So lassen sich zweifellos Energie und Heizkosten sparen. Das ist zum Beispiel in Einfamilienhäusern praktisch, aus denen der Nachwuchs bereits ausgezogen ist, sodass den Großteil des Jahres in einigen Räumen kein Heizbedarf besteht.
Den Altbau mit Infrarot beheizen: Ja oder Nein?
Zu sagen, Infrarotheizungen seien zu teuer für Altbauten, wäre eine nichtzutreffende Verallgemeinerung. Ob diese Heiztechnologie als Ersatz für ein komplettes, bereits bestehendes Heizsystem wie zum Beispiel eine Kesselheizung geeignet ist, hängt vom Zustand der Immobilie ab.
Als Zusatzheizung kann die Infrarotheizung aber durchaus eine gute Wahl sein. Sie ist leicht zu installieren, punktuell einsetzbar und als Wandheizung oder Deckenheizung sehr platzsparend im Einsatz.
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine Altbauwohnung mit Infrarot zu beheizen, sollten Sie auf umfassende professionelle Beratung nicht verzichten. Denn auch der beste Infrarotheizungs-Rechner kann nicht die Einschätzung eines Experten ersetzen. Denken Sie immer daran: Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Altbau und Infrarotheizung nicht zusammenpassen. Wer weiß – vielleicht ist die Infrarotheizung genau das, worauf Ihre Altbauwohnung gewartet hat!
Unsere Produkttipps für Ihre Altbauwohnung
FAQs: Häufig gestellte Fragen zum Thema “Verbrauch im Altbau”
Welche Heizung ist die beste für den Altbau?
Dass eine Infrarotheizung zu teuer für den Altbau ist, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Zu hohe Kosten ergeben sich nur dann, wenn das zu beheizende Gebäude die falschen Voraussetzungen mit sich bringt (z. B. schlechte Dämmung). Falls es sich jedoch um eine gut erhaltene und sanierte Immobilie handelt, kann eine Infrarotheizung eine sinnvolle Heizlösung sein.
Als Zusatzheizung eignet sich die Infrarotheizung hervorragend – sie überzeugt mit einigen lohnenswerten Vorteilen. So lassen sich unsere Modelle schnell und einfach an Wand und Decke montieren, sind platzsparend und machen das punktuelle Heizen möglich. Wenn Sie über das Heizen mit Infrarotwärme im Altbau nachdenken, sollten Sie sich allerdings in jedem Fall umfassend beraten lassen.
Wie viel Watt pro m2 Infrarotheizung?
Je nach Raumgröße, Anzahl der Außenwände und Außentemperaturen müssen Infrarotheizungen bestimmte Wattleistungen erbringen, damit angenehme Wärme entstehen kann. Grundsätzlich gilt: Mit zunehmender Raumgröße steigt auch die Wattanzahl.
Um herauszufinden, welche Wattleistung eine zukünftige Infrarotheizung erreichen soll, müssen in einem ersten Planungsschritt die Maße des ausgewählten Raumes bestimmt und die Außenwände abgezählt werden. Danach kann man die benötigte Wattleistung ermitteln. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Anhaltspunkt. Für genauer Berechnung kontaktieren Sie bitte das Heatness Team damit sichergestellt wird, dass Sie auch die richtige Heizung auswählen. Gerne übernehmen wir eine kostenlose und unverbindliche Berechnung für Sie.
| Heizleistung | 1 Außenwand | 2 Außenwände | 3 Außenwände | 4 Außenwände |
|---|---|---|---|---|
| 300 W | bis 5 m² | bis 4 m² | bis 3 m² | bis 2 m² |
| 400 W | bis 10 m² | bis 8 m² | bis 6 m² | bis 4 m² |
| 500 W | bis 12 m² | bis 10 m² | bis 8 m² | bis 6 m² |
| 600 W | bis 14 m² | bis 12 m² | bis 10 m² | bis 8 m² |
| 700 W | bis 16 m² | bis 13 m² | bis 11 m² | bis 10 m² |
| 800 W | bis 18 m² | bis 16 m² | bis 13 m² | bis 11 m² |
| 900 W | bis 20 m² | bis 18 m² | bis 16 m² | bis 13 m² |
Wie effektiv sind Infrarotheizungen?
Infrarotheizungen liegt eine ausgeklügelte Technik zugrunde, die konventionelle Heizsysteme in den Schatten stellt. Beim Heizen mit Infrarotwärme wird nicht die Luft, sondern Möbelstücke, Wände, Boden und Decke erwärmt. Die angestrahlten Gegenstände und Begrenzungsflächen speichern die Wärme zunächst und geben sie dann nach und nach in den jeweiligen Raum ab.
Weil nicht die Luft als primärer Wärmespeicher fungiert, kommt es nur bedingt zu Wärmeverlusten – selbst beim Stoßlüften. Außerdem sorgen Infrarotheizungen für trockene Wände, wodurch der Schimmelbildung gezielt entgegengewirkt werden kann. Beim Heizen mit Infrarot entsteht also langfristige Wärme, die noch dazu das allgemeine Wohlbefinden steigert.
Wie berechnet man die benötigte Heizleistung?
Die Heizleistung gibt an, welche Wattleistung eine Infrarotheizung erbringen muss, damit die ausgewählte Wunschtemperatur erreicht werden kann. Die Heizleistung kann ganz einfach selbst berechnet werden. Dazu braucht man die folgende Formel:
Benötigte Leistung (in W) = Raumgröße (in m2) * spezifische Heizleistung (in W/m2)
Für die Raumgröße misst man einfach die Länge und Breite ab und multiplizieren die beiden Werte miteinander. Für die spezifische Heizleistung muss man die gewünschte Temperatur und das Baujahr der Immobilie wissen. Die genauen Werte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
| Baujahr | Heizleistung für 18 °C | Heizleistung für 20 °C | Heizleistung für 24 °C |
|---|---|---|---|
| vor 1982 | 112 W/m² | 122 W/m² | 142 W/m² |
| 1983-1994 | 91 W/m² | 99 W/m² | 116 W/m² |
| nach 1994 | 74 W/m² | 81 W/m² | 95 W/m² |
Welche Heizkörpergröße für den Raum?
Bei heatness® finden Sie Infrarotheizungen in verschiedenen Größen. Die richtige Größe richtet sich dabei immer nach den Raummaßen und dem individuellen Heizbedarf. Bevor man sich für ein bestimmtes Modell entscheidet, sollte man daher die Raumgröße bestimmen. In unserem Ratgeber zum Thema “Welche Infrarotheizung für welche Raumgröße?” finden Sie konkrete Raum- und Praxisbeispiele.